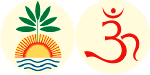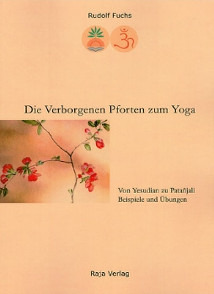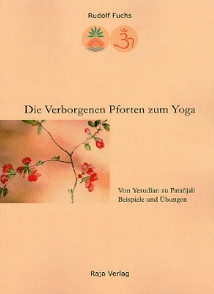Gunas
abhyāsa-vairāgyābhyāṃ tan-nirodhaḥ // 1,12//
Die Stilllegung (der citta-vṛttis erreicht man) durch Übung und
Leidenschaftslosigkeit.
tatra sthitau yatno’bhyāsaḥ // I, 13 //
Die Bemühung, dort (beständig) zu verweilen, (ist) Übung.
sa tu dīrgha-kāla-nairantarya-satkāra-āsevito dṛḍha-bhūmiḥ // I, 14 //
Diese (Übung) aber gewinnt nur dann festen Boden, (wenn sie) lange Zeit
ununterbrochen in rechter Weise betrieben (wird).
dṛṣṭa-anuśravika-viṣaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-saṃjñā vairāgyam // 1.15 //
Die Bewusstheit der Selbstbeherrschung eines (Menschen), der frei
vom Verlangen nach gesehenen und gehörten Dingen ist,
(nennt man) Leidenschaftslosigkeit
tatparaṃ puruṣa-khyāter guṇa-vaitṛṣṇyam // 1.16 //
Deren höchste (Stufe ist) der durch Erkenntnis des Selbst
(bewirkte) Gleichmut gegen die (drei) guṇas.
Anmerkung
guṇas sind – gemäß dem „Sānkhya„, das dem „Yoga“ als ein anderes der sechs klassischen Philosophiesysteme Indiens gegenübersteht – Grundeigenschaften der Erscheinungswelt. Der Begriff guṇa taucht in den Yoga-Sūtras nur zweimal auf, ohne dass die guṇas dort im Einzelnen definiert werden. Allerdings gelten die in Sūtra II,18 gebrauchten Begriffe sthiti, kriyā und prakāśa als Synonym zu den im Sānkhya gebrauchten Worten tamas, rajas und sattva. Nach Helmut Maldoner (von dem auch die Übersetzung der oben angeführten Sūtras stammt) sind „Beharrung, Tätigkeit, Licht“ Entsprechungen in unserer Sprache.
In unserer Schule versuchen wir auf die Übersetzung von Erlebniszuständen (wie z. B. āsanas und mudrās welche sind) möglichst zu verzichten: Wer übt, merkt bald, welches eigene Erlebnis er/sie mit tamas, rajas und sattva bezeichnen möchte. Bei diesem Verfahren wird der ganze Ballast von Assoziationen, die den Wörtern unserer Sprache natürlicherweise anhaften, nicht auf ein neues Erlebnis übertragen.
Zuerst muss – aufs Neue – geklärt werden, warum wir Yoga üben. Natürlich für unser Wohlbefinden. Vielleicht ist aber zur Zeit unser Blick getrübt oder reicht nicht weit genug. Mit den wechselnden Befindlichkeiten des Tages oder der „Last“ der gelebten Jahre befasst sich der Yoga eigentlich nicht, oder nur dann, wenn die mit ihnen verbundenen Probleme als Chance erkannt, das heißt, gerade sie als Gelegenheit akzeptiert werden, das Blickfeld zu erweitern. Aber – und das ist der springende Punkt – das erweiterte Blickfeld liegt nicht im, sondern über dem machbaren Bereich, und wird erst erkennbar, nachdem das Machbare absolviert wurde.
Der Yoga ist für alle da, für Junge und Alte, für Gesunde und Kranke, für Einsichtige und für Nicht-Einsichtige. Für alle gibt es im Yoga den passenden Anfang, und es sollte auch für alle einen passenden Lehrer geben. Die Qualität… (weiter zu – Gunas Seite 2 – Was ist nirodha?)
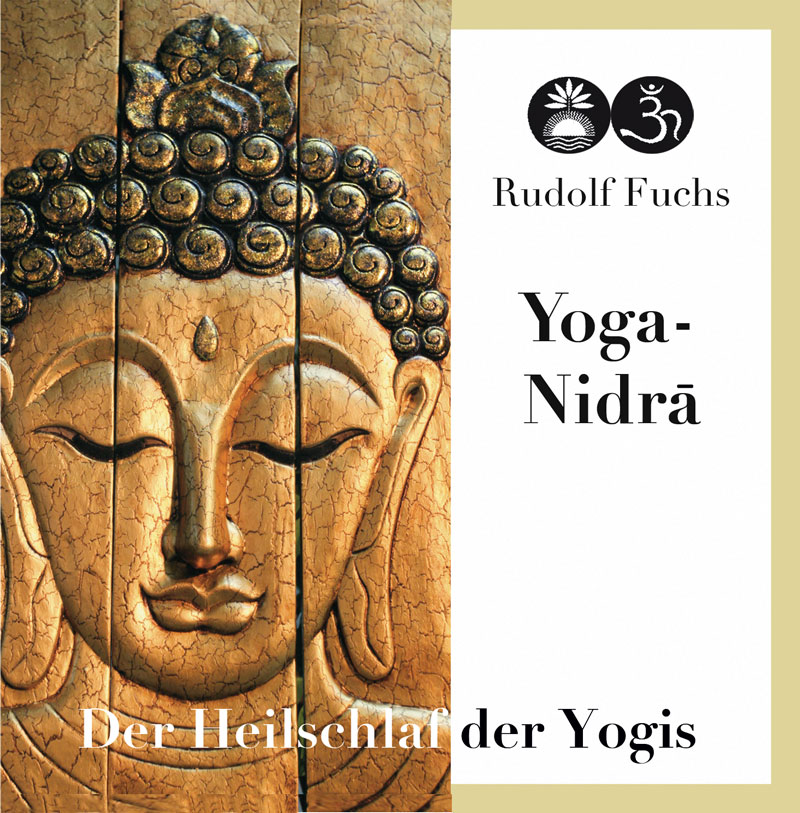
Yoga Nidrā – Der Heilschlaf der Yogis
Zwei Übungen von jeweils 30 Min